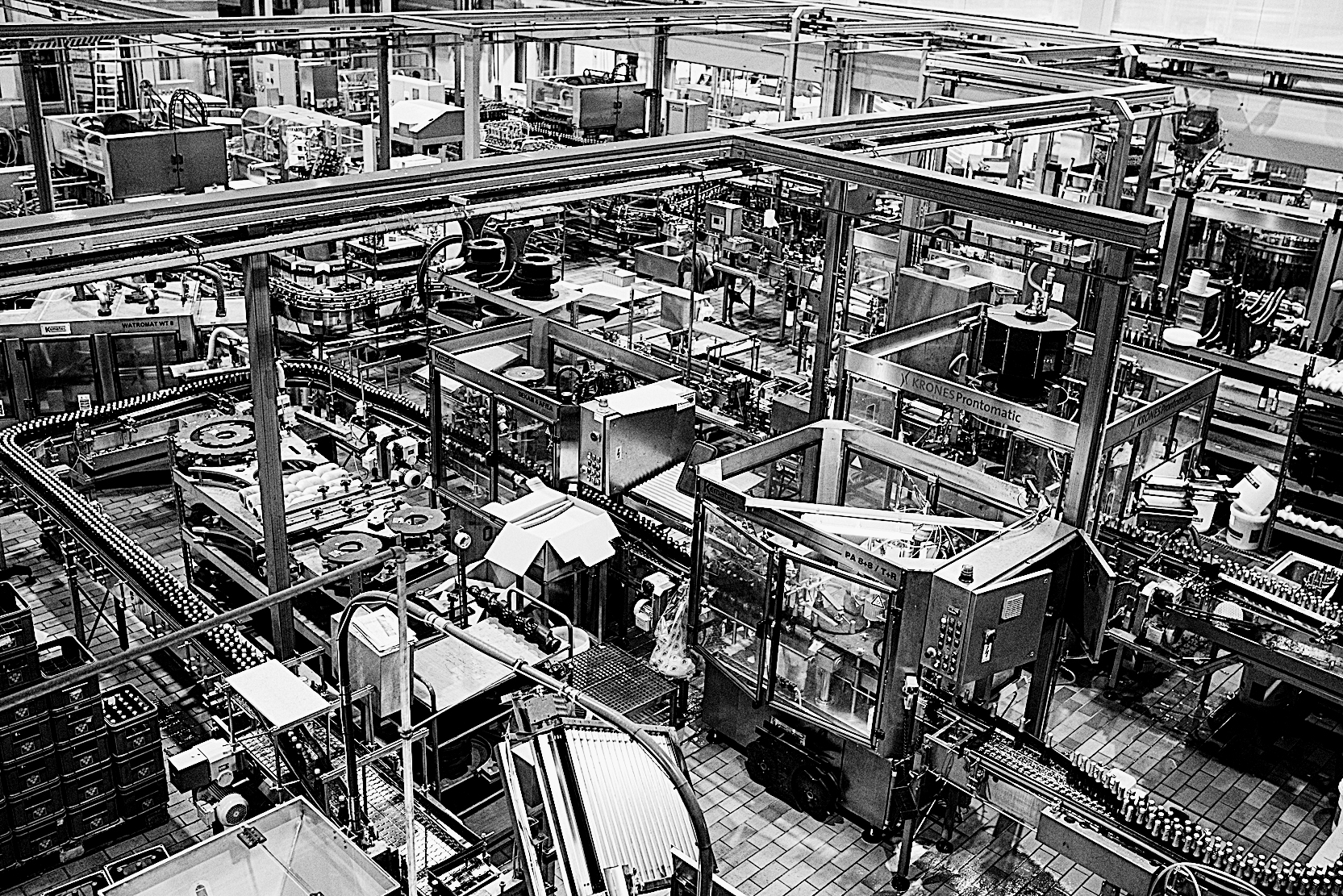„Traditionell wurden in Luxemburg seit der Römerzeit Heunisch, Elbling sowie Riesling angebaut. Erst nach dem Ersten Weltkrieg pflanzte die Winzerschaft vermehrt Rivaner aber auch Burgundersorten, wie zum Beispiel Auxerrois oder Pinot Blanc, an. Noch bis in die 80-er Jahre hinein erlebte hauptsächlich der Rivaner seine Blüte und stellte den typischen Luxemburger Weinstil dar. Aromatisch, leicht und trocken passte dieser Wein zu jedem Anlass“, schreiben die Verantwortlichen des Weinbauinstituts in Das Weinjahr 2016.
Doch die „Blüte des Rivaners“ ist vorbei und die des Elblings ebenfalls. Noch 1997 waren 50 Prozent der Luxemburger Weinberge mit Rivaner und Elbling bepflanzt, vergangenes Jahr waren es nur noch 30 Prozent. Wobei der Rivaner mit 306 Hektar mit Abstand die häufigste Rebsorte an der Luxemburger Mosel bleibt, die zweithäufigste Sorte, der Grauburgunder, wird auf 197 Hektar angebaut. Nur trinken wollen den Rivaner noch die wenigsten Kunden. Im Supermarkt ist er in Literflaschen ab drei Euro erhältlich. Er hat einen dermaßen schlechten Ruf, dass ihn die Vinsmoselle, mengenmäßig der größte Rivanerproduzent, in ihrem eigenen Webshop nicht verkauft, so sehr schämt sie sich für ihr Produkt.
Elbling findet der Kunde im Handel und in der Gastronomie kaum noch; er wird vor allem zu Crémant verarbeitet. Doch dazu eignet sich der Rivaner nicht so gut. Insgesamt, musste der Luxemburger Weinbau in den vergangenen Jahren immer wieder feststellen, trinken die Verbraucher weniger. Daran sind nicht nur die stetig gesenkten gesetzlichen Alkohollimits im Straßenverkehr Schuld, sondern auch das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher insgesamt, meint Claire Sertznig vom Weinbau-Institut in Remich. Das ist keine spezifisch luxemburgische Entwicklung. Doch für die Luxemburger Winzer wurde es in den vergangenen Jahren auch deshalb zunehmend schwerer, ihre Produkte abzusetzen, weil Luxemburg ein Immigrationsland ist. Kommen die Zuwanderer, wie Franzosen, Portugiesen, Spanier oder Italiener, aus Ländern mit eigener Weintradition, bringen sie oft ihre eigenen Weine mit. Gibt es in der Heimat, beispielsweise in Großbritannien oder in Skandinavien, keine nennenswerte Produktion, kaufen sie dennoch oft französischen, italienischen, spanischen oder portugiesischen Wein – auch weil sie nicht wissen, dass es luxemburgischen gibt.
Das alles ist an der Mosel schon seit Jahren bekannt. Wieso also nicht die Produktion umstellen, auf Weine, die bei den Verbrauchern beliebter sind? Das ist erstens nicht so einfach, weil Rebstöcke mehrere Jahrzehnte im Berg stehen, der Ertrag ist erst niedrig, dann steigt er, bevor er wieder sinkt. Roden und Ersetzen ist deshalb ein größerer Eingriff in die Produktion eines jeden Betriebs. Und zweitens, weil Luxemburg immer noch an der Mosel und nicht an der Loire liegt: Die Lagen, die jetzt noch mit Rivaner bestockt sind, eignen sich kaum für den Anbau anderer Sorten, so die Erklärung.
Daher waren die Unternehmensberater E&Y vom Landwirtschaftsministerium und dem Weinbauinstitut bestellt worden, eine Studie anzufertigen, um zusammen mit den Winzern nach Lösungen zu suchen. Die Ergebnisse wurden vergangenen Sommer vorgestellt. Claire Sertznig verdankt ihren Job dieser Studie – sie ist die „Pilotin“, die den Beruf, also die Vertreter der Privatwinzer, der Kooperative und der Weinhändler, in den Arbeitsgruppen begleiten soll, in denen sie die Empfehlungen der Unternehmensberater zusammen in konkrete Aktionen umsetzen sollen.
Diese Woche haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Die zahlreichen Einzelempfehlungen von E&Y haben sie auf drei große Themenbereiche zusammengefasst: Ereignisse, Kommunikation und Marketing und die Appelation d’origine protégée (AOP). Im Großen und Ganzen geht es darum, der Kundschaft im In- und Ausland klarzumachen, dass es den Luxemburger Wein gibt und dass er nicht schlechter ist als der aus anderen Weinbauregionen.
Um mehr Wein exportieren zu können, soll einerseits das Image der Luxemburger Produkte im traditionellen Absatzmarkt Belgien aufgewertet werden, und als neuen Markt mit Potenzial wurden deutsche Großstädte wie Berlin, Hamburg, Köln oder München ausgemacht. Diese Städte liegen nicht direkt an einem Weinbaugebiet, erklärt Sertznig, doch gebe es dort eine junge, urbane Kundschaft, die gerne Wein trinke. Der Weg des Luxemburger Weins in ihre Gläser soll über die Gastronomie und den Fachhandel führen. Auch in Belgien will man verstärkt auf Gastronomie und Fachhandel setzen, um qualitativ hochwertigeren Luxemburger Wein anzubieten als es ihn bisher im belgischen Einzelhandel zu kaufen gab. Auf dem Terminkalender stehen daher als Ereignisse Fachmessen wie die Horcatel in Belgien, die größte internationale Branchenmesse überhaupt, die Prowein in Düsseldorf, die Weinmesse in Offenburg, wo Luxemburg als Gastregion eingeladen ist, oder noch das Forum Vini in München. Nicht dass Luxemburger Winzer bei diesen Messen nicht schon in der Vergangenheit dabei gewesen wären. In Zukunft sollen sie dort an einem Gemeinschaftsstand auftreten, mit einer gemeinsamen, Luxemburger „Identität“. An deren Ausarbeitung feilt die Arbeitsgruppe „Ereignisse“ seit dieser Woche und sie soll für nächstes Jahr einsatzbereit sein. Beim letzten Forum Vini in München haben die Winzer erste Erfahrungen mit einem gemeinsamen Auftritt gesammelt. Das Fazit derer, die vorher dort mit einem eigenen Stand auf Kundensuche gingen, war durchweg positiv, erzählt Sertznig, weil ihnen der größere Gemeinschaftsstand mehr Aufmerksamkeit und Zulauf gebracht habe. Die Luxemburger Mosel, meint sie, habe gute Argumente zu bieten. Als Weingebiet habe es wegen der geringen Anbaufläche von 1 300 Hektar insgesamt „Exotencharakter“. Da die Winzer gezwungenermaßen keine Massenprodukte herstellen können, seien sie auf Qualität bedacht und genau solche Nischenprodukte seien in der Gastronomie gesucht.
Hat man es in die Restaurants und Kneipen von Berlin und München geschafft, will man in einem zweiten Schritt versuchen, eine andere Besonderheit des deutschen Marktes für sich zu nutzen: den Onlinehandel. Denn die Deutschen bestellen wie es scheint, nicht nur Bücher, Elektronikartikel und Kleider im Internet, sondern auch Wein. „Eine Gruppe wie Hawesko macht einen Umsatz von 507 Millionen Euro jährlich“, sagt Sertznig. Hawesko.de ist der Online-Auftritt des Unternehmens, zu dem auch Jacques’ Wein-Depot gehört, der größte Weinfachhandel in Deutschland. „Wenn die Kunden den Wein im Restaurant probiert haben und er ihnen schmeckt, bestellen sie ihn danach im Internet“, so die „Pilotin“. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man deshalb im Online-Handel präsent sein.“ Luxemburger Weine sucht man auf der hawesco.de genauso vergeblich wie auf wine-in-black.de oder vicampo.de, den anderen großen Online-Plattformen. Auf Hawesco und Wine in black findet man nicht einmal einen Rivaner, beziehungsweise einen Müller-Thurgau, wie die Rebsorte in Deutschland genannt wird und als solche eigentlich keinen schlechteren Ruf hat als andere Sorten. Vicampo hat sowohl Muller Thurgau als auch Rivaner im Angebot. Der billigste kostet 4,80 Euro in der Literflasche, der teuerste, eine Auslese von 1995, 18 Euro. Die meisten deutschen Winzer bieten ihren Muller Thurgau dort zu Preisen zwischen sieben und zwölf Euro die Flasche an, eine ganze Reihe sind ausverkauft.
Die schwierige Diskussion, wie es mit dem Rivaner weitergehen soll, ist in die „technischere“ Arbeitsgruppe AOP eingebettet. Dort wird es darum gehen, das Kennzeichnungssystem, das zwischen „Cotes“, „Coteaux“ und Lagenweinen unterscheidet und erst 2014 die Marque nationale abgelöst hat, so zu gestalten, dass der Kunde versteht, welchen der drei Kategorien das einfachere, beziehungsweise das anspruchsvollere Lastenheft zugrunde liegt, also welcher Wein im Prinzip weniger gut und welcher besser ist. Dass dies für die Verbraucher bisher nicht nachvollziehbar ist, dessen „sind wir und bewusst“, räumt Sertznig ein.
Die Besprechungen in den Arbeitsgruppen fangen gerade erst an, und Sertznig betont, nicht sie treffe die Entscheidungen, sondern die Winzer. Aber zu den Möglichkeiten, die überhaupt in Frage kommen, gehört die, die Bezeichnung Rivaner an ein neues, anspruchsvolleres Lastenheft zu koppeln, um die Qualität zu steigern – „da gibt es noch Luft nach oben“-, und sicherzustellen, dass nur noch hochwertiger Wein unter diesem Namen auf den Markt kommt. Die Verbraucher, meint Sertznig, könne man auf „spielerische Art“ wieder an den Rivaner heranführen. Bei Blindverkostungen, in die der Rivaner hineingeschmuggelt werde, schneide er sowohl bei Professionellen als auch bei Konsumenten meistens gut ab. Erst wenn sie wüssten, dass sie Rivaner tränken, ändere sich die Einstellung. Eine andere Möglichkeit wäre die, den so negativ besetzten Namen Rivaner einfach ganz fallen zu lassen und stattdessen in Verbindung mit anspruchsvolleren Produktionskriterien in Zukunft auf den deutschen Namen der Rebe Muller Thurgau zu setzen. Denn dass es dieselbe Rebe ist, wissen wohl die wenigsten Verbraucher und haben daher wahrscheinlich weniger Vorurteile gegen einen Muller Thurgau als gegen einen Rivaner.
Ein neues Lastenheft und eine Überarbeitung der AOP überhaupt kann vielleicht dazu beitragen, ein anderes Problem zu lösen: die Lücke in der Luxemburger Weinpreistabelle, die zwischen fünf und fünfzehn Euro klafft. Die stellt vor allem die Pläne in Frage, in der Gastronomie Fuß zu fassen. Denn wenn der Restaurateur den Preis verdreifacht, kostet die 15-Euro-Flasche beim Essen gleich 45 Euro. Von einer solchen Flasche, ist sich auch Sertznig bewusst, bestelle der Kunde weniger schnell eine zweite, als von einer Sorte, die für 25 Euro auf der Karte steht. Das, fügt sie hinzu, sei vor allem in Luxemburg ein Problem. Weil die Kunden die Preise für Luxemburger Weine besser kennen als die für ausländische Weine, erscheine ihnen der Preis für eine Flasche von der Mosel eher unangemessen als der für ausländischen Wein.